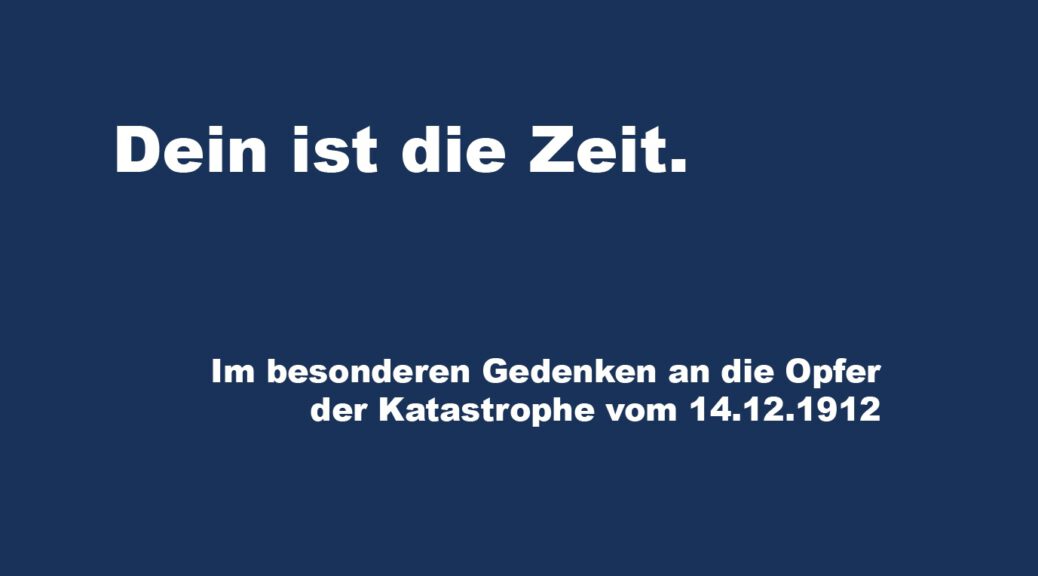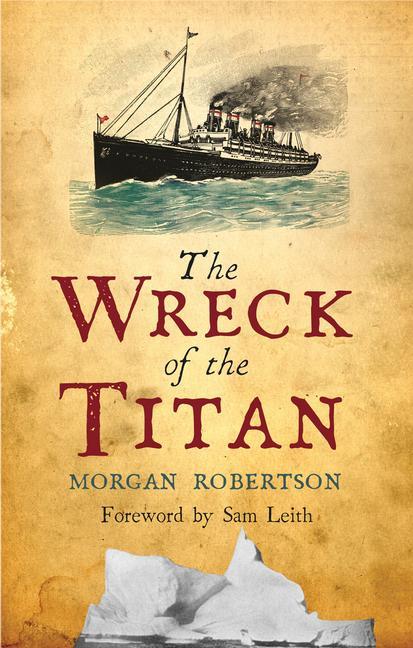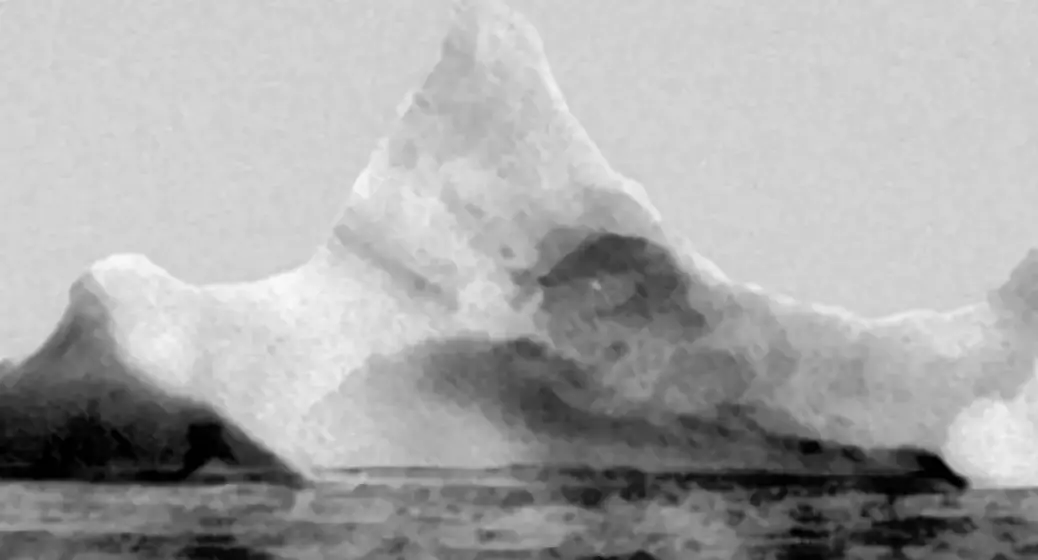Bastian Balthasar Bux ist ein zehn- bis elfjähriger, fantasievoller, aber unsicherer Junge. Nach dem Tod seiner Mutter hat sich sein Vater in die Arbeit geflüchtet und schenkt ihm kaum Beachtung. In der Schule ist Bastian ein Außenseiter und wird gehänselt. Auf der Flucht vor seinen Mitschülern versteckt er sich im Antiquariat von Karl Konrad Koreander. Dort entdeckt er ein geheimnisvolles Buch, Die unendliche Geschichte, das er stiehlt und auf dem Dachboden seiner Schule zu lesen beginnt.
Das Buch erzählt vom Reich Phantásien, das vom Nichts bedroht wird. Die Kindliche Kaiserin, Herrscherin Phantásiens, ist schwer krank. Sie beauftragt den Jungen Atréju, ein Heilmittel zu finden. Auf seiner Reise begegnet er vielen Wesen, darunter dem Glücksdrachen Fuchur. Schließlich erkennt Atréju, dass die Kaiserin nur gerettet werden kann, wenn ihr ein Menschenkind einen neuen Namen gibt.
Während Bastian liest, überschneiden sich Realität und Geschichte. Atréju sieht Bastians Bild im Zauberspiegel, und Bastian begreift, dass er der Retter ist. Zunächst zögert er, doch als Phantásien fast verloren ist, gibt er der Kaiserin den Namen Mondenkind. Damit tritt er selbst in Phantásien ein.
Die Kaiserin übergibt Bastian das Amulett Auryn, das jeden Wunsch erfüllt. Doch jeder Wunsch kostet ihn eine Erinnerung an sein Leben in der Menschenwelt. Anfangs wünscht sich Bastian, schön, stark und mutig zu sein, und erschafft damit neue Orte und Wesen. Er gefällt sich in seiner Rolle als Erneuerer Phantásiens, lehnt aber die Rückkehr in seine Welt ab.
Wieder begegnet er Atréju und Fuchur, doch seine wachsende Machtgier, verstärkt durch die Hexe Xayíde, entfremdet ihn von seinen Freunden. Er träumt davon, selbst Kaiser von Phantásien zu werden. Als Atréju versucht, ihn aufzuhalten, kommt es zu einer Schlacht am Elfenbeinturm, in der Bastian Atréju verwundet.
Schließlich gelangt Bastian in die Alte-Kaiser-Stadt, wo Menschen gestrandet sind, die nie den Weg zurückfanden. Dort erkennt er, dass er nur noch so viele Wünsche hat, wie Erinnerungen übrig sind. Um heimzukehren, muss er seinen wahren Willen erkennen. Seine Wünsche führen ihn zu Gemeinschaft, Geborgenheit und schließlich zur Liebe.
Mit Atréjus Hilfe erreicht er den innersten Ort Phantásiens, wo das Wasser des Lebens fließt. Er trinkt davon, findet zu seinem wahren Ich und legt Auryn ab. Er nimmt den Entschluss, das Wasser seinem Vater zu bringen, und kehrt in die Menschenwelt zurück. Obwohl dort nur wenige Stunden vergangen sind, ist Bastian durch seine Reise verändert. Er erzählt seinem Vater von seinen Erlebnissen, und die beiden finden zu einer neuen, liebevollen Beziehung.
Die zentrale Aussage des Romans besteht darin, dass die Reise in die Welt der Phantasie nicht bloße Flucht bedeutet, sondern Quelle neuer Ideen und Einsichten ist. Durch das Träumen und Eintauchen in Fantasiewelten lernen Menschen, die verborgene Schönheit des Alltäglichen neu zu sehen und wertzuschätzen. Michael Ende betont, dass Phantasie an sich weder gut noch böse ist; ihre moralische Bedeutung erhält sie erst durch das Handeln, das aus ihr hervorgeht. Sie kann zu Kreativität, Liebe und Mitmenschlichkeit führen, aber auch missbraucht werden – etwa in Form von Lügen, die Macht und Manipulation erzeugen. Der Roman macht deutlich, dass wahre Wünsche in Gemeinschaft, Verantwortung und Liebe liegen. Nur wenn Phantasie dazu genutzt wird, die Realität bewusst und positiv zu gestalten, erfüllt sie ihren tiefsten Sinn.
Die vorliegende Inhaltsangabe basiert auf dem Wikipedia-Artikel Die unendliche Geschichte tark gekürzt und zusammengefasst (vgl. Wikipedia „Die Unendliche Geschichte (Roman)“ abergufen am 26.09.2025