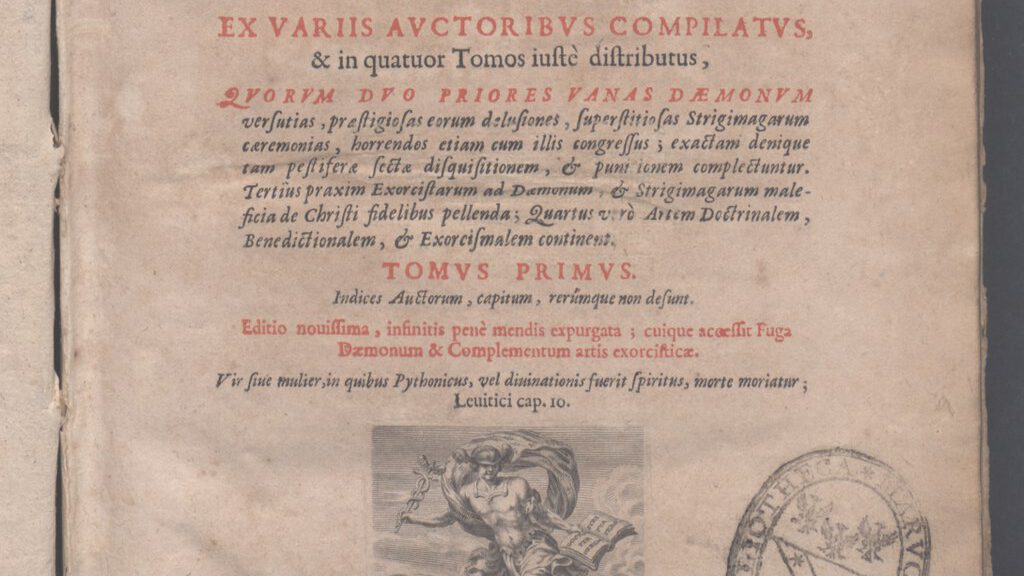Für dich hier der unegkürzte Artikel von Bastian Berbner ais DIE ZEIT / 30 / 2020
Wie rassistisch sind Sie?
Die meisten weißen Menschen sind überzeugt: Hautfarbe spielt für mich keine Rolle. Schön wär’s
Wäre die Welt ausschließlich vom Verstand regiert, hätte der Rassismus spätestens am 26. Juni 2000 sterben müssen. An diesem Tag betrat Bill Clinton den East Room des Weißen Hauses, wo Journalisten und Wissenschaftler auf ihn warteten. Der amerikanische Präsident federte herein, lächelnd, siegesgewiss. Wenn man heute die Videoaufnahme ansieht, denkt man: Er hat den Gegner unterschätzt. Clinton verkündete, es sei gelungen, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Mehr als tausend Wissenschaftler weltweit hatten daran gearbeitet, maßgeblich finanziert von der amerikanischen Regierung. Diese triumphale Reise ins Innere des menschlichen Genoms, sagte Clinton, werde viele Erkenntnisse bringen. Eine Wahrheit offenbare sie bereits jetzt: »Menschen, egal welcher Rasse, sind zu mehr als 99,9 Prozent gleich.«
Jahrhundertelang hatte der Glaube geherrscht, dass die Herkunft von Menschen nicht nur ihr Äußeres festlegt, ihre Hautfarbe, ihren Haarwuchs, ihren Körperbau, sondern auch ihr Inneres, ihre Intelligenz, ihre Moral, ihre Gefühle. Doch in den Jahrzehnten zuvor hatte die Wissenschaft daran zu zweifeln begonnen. Je mehr Biologen darüber lernten, was Gene sind und wie sie funktionieren, desto klarer wurde ihnen, dass eine neue Theorie nötig war. Sie geht so:
Alle Menschen auf der Erde stammen von gemeinsamen Vorfahren ab, die in Afrika lebten. Vor etwa 70.000 Jahren zogen einige Homo sapiens Richtung Nordosten, sie sahen einander ähnlich, ihre Haut war schwarz. Sie besiedelten den Nahen Osten, dann Asien und Australien, später Europa und Amerika. So verschieden waren die Orte, an denen die Einwanderer jetzt lebten, dass ihre Körper sich daran anpassten. Wo die Sonne wenig schien, wurde ihre Haut heller, um weiter ausreichend Vitamin D bilden zu können. In der Arktis entwickelten die Inuit ein Enzym, das dabei hilft, Omega-3-Fettsäuren aus Fischen zu verarbeiten. In Südostasien bildeten die Seenomaden vom Volk der Bajau ungewöhnlich große Milzen aus, um bei langen Tauchgängen den Sauerstoffgehalt ihres Blutes konstant zu halten. Im Westen Kenias gab die Evolution den Kalendjin einen Körperbau, mit dem sie sehr schnell sehr lange Strecken zurücklegen können, zum Beispiel die 42,195 Kilometer eines Marathons. In den Anden hatten die Menschen irgendwann eine etwas größere Lunge, um in der Höhe effizienter atmen zu können. Rein äußerlich betrachtet, wirken diese Unterschiede zwischen den Menschen groß. Doch als die Forscher jetzt sämtliche Buchstaben der menschlichen DNA mit ihren drei Milliarden Basenpaaren aneinanderreihten, da war es nicht mehr zu leugnen: In Wahrheit sind die Unterschiede oberflächlich. Rein genetisch betrachtet, ist eine Herde Pinguine vielfältiger als die gesamte Menschheit, und zwei Schwarze können sich stärker voneinander unterscheiden als ein Weißer und ein Schwarzer. Es ist sinnlos, Menschen danach in Gruppen zu sortieren, welche Hautfarbe sie haben. Was Clinton verkündete, war der Beweis: Es gibt keine Menschenrassen. Keine Herren- und keine Untermenschen. Kein höherwertiges und kein minderwertiges Leben. Der Rassismus, die tödlichste Ideologie aller Zeiten, hatte sein Fundament verloren. Im East Room des Weißen Hauses schloss Bill Clinton mit dem Satz: »Mein größter Wunsch ist, dass diese glühende Wahrheit immer unser Handeln leiten wird.«Das ist 20 Jahre her. Es war nicht das Ende des Rassismus. Nicht mal annähernd, wenn man sieht, wer heute Clintons Amt innehat. Wenn man sieht, mit welcher Wucht sich die Proteste nach dem Tod des Amerikaners George Floyd um die Welt ausbreiteten.
In Sydney, Paris, Mailand, Oslo und Berlin protestierten in den vergangenen Wochen jeweils Zehntausende, in Solidarität mit dem schwarzen Amerika, aber auch getrieben von Wut auf die Lage im jeweils eigenen Land. Überall berichteten Menschen mit neuem Mut von alten Mustern: der französische Teenager, der mit Freunden in Paris unterwegs war, als Polizisten alle Taschen und Handys kontrollierten, nur die von einem nicht – dem einzigen Weißen in der Gruppe. Italienische Frauen, die wegen ihrer dunklen Haut auf der Straße angesprochen werden wie Prostituierte. Die Mitglieder der afrikanischen Community im chinesischen Guangzhou, denen mit einem Schild der Zutritt zu McDonald’s verwehrt wurde: »Schwarze Menschen dürfen das Restaurant nicht betreten.« Der Hamburger, den ein Passant beschimpfte: »Verpiss dich nach Afrika!« So allgegenwärtig ist Rassismus, als seien Clintons Worte damals einfach verpufft. So lebendig ist er, dass viele, die darunter leiden, ihn nicht einfach auf den einen hasserfüllten Polizisten, die eine unsensible Chefin, den einen feindseligen Lehrer zurückführen. Sondern auf eine Struktur, ein System. Da dieser Artikel in einer deutschen Zeitung erscheint, wäre es gut, an dieser Stelle über Deutschland zu schreiben. Nach allem, was in der letzten Zeit geschehen ist, kann kein Zweifel daran bestehen, dass es auch hier ein Rassismus-Problem gibt. Wie groß es ist, lässt sich allerdings schwer sagen. In Deutschland unterscheiden Statistiken nicht nach ethnischer Herkunft oder Hautfarbe, lassen also keine genaue Aussage über die Diskriminierung von, zum Beispiel, schwarzen Deutschen zu. Es ist nicht einmal bekannt, wie viele schwarze Menschen hier leben. Schätzungen gehen von mehr als einer Million aus. Auch für andere westliche Staaten fehlen verlässliche Daten. Ein Land aber dokumentiert den Rassismus in seinem Inneren so genau wie kein anderes.
Die USA, 2020: Schwarze verdienen weniger als Weiße, erzielen beim Verhandeln über den Preis eines Autos schlechtere Resultate, landen eher im Gefängnis, bekommen von Ärzten weniger Schmerzmittel verschrieben und von Immobilienmaklern unattraktivere Objekte gezeigt. All das gilt auch dann, wenn man die größere Armut, das niedrigere Bildungsniveau und die höhere Kriminalitätsrate der schwarzen Bevölkerung aus der Statistik herausrechnet. Das System des Rassismus, es existiert also wirklich. Schwarze werden dafür diskriminiert, dass sie schwarz sind.Das ist die eine Wahrheit. Es gibt noch eine andere.
In den vergangenen Jahrzehnten, während die Biologie dem Rassismus sein pseudowissenschaftliches Fundament entzog, hat sich die Einstellung der Amerikaner durchaus verändert, und zwar zum Positiven. Sind Sie dafür, dass Schwarze und Weiße einander heiraten dürfen? Können Sie sich vorstellen, einen qualifizierten schwarzen Kandidaten zum Präsidenten zu wählen? Auf solche Umfragen antwortet heute – im Gegensatz zu früher – eine überwältigende Mehrheit der weißen Amerikaner mit Ja.
Und sie reden nicht nur, sie handeln auch. Sie haben zum Beispiel Barack Obama gewählt. Gesetze gegen Diskriminierung verabschiedet. Schwarze Autoren, die über Rassismus schreiben, mit Literaturpreisen ausgezeichnet, ihre Bücher zu Bestsellern gemacht. Immer mehr Schwarze und Weiße heiraten einander. Es gibt heute in den USA deutlich weniger Weiße, die sich ihren schwarzen Mitbürgern überlegen fühlen, als noch vor einigen Jahrzehnten. Und deutlich mehr Weiße, die es ehrlich gut meinen. Warum aber verschwindet mit den Rassisten nicht auch der Rassismus? Man kann ja nicht beides gleichzeitig sein, Rassist und Nichtrassist.Oder vielleicht doch?
Im Sommer 1994 bekam die Sozialpsychologin Mahzarin Banaji eine E-Mail von einem Kollegen. Banaji war damals eine aufstrebende Wissenschaftlerin an der Universität Yale. Ihr Kollege, Tony Greenwald, mit dem sie seit einer Weile zusammenarbeitete, hatte den ersten Entwurf eines psychologischen Tests entwickelt, den er ihr nun zur Ansicht schickte. Sie setzte sich an ihren Esstisch, auf dem ihr Computer stand, und öffnete die Datei. »Kein Tag hat mein Leben mehr verändert als dieser«, sagt sie heute. Dazu muss man wissen, dass Banaji aus Südindien stammt. Selbstverständlich sei sie damals davon überzeugt gewesen, keine Vorurteile gegen Schwarze zu haben, erzählt sie am Telefon, sie habe ja selbst braune Haut. Und: Sie lehrte an einer Elite-Uni an der Ostküste, sie war umgeben von Freunden und Kollegen, die sich für genauso aufgeklärt hielten wie sie selbst. Auf dem Bildschirm sah Banaji eine Folge von Wörtern und Vornamen. Die Wörter waren klar positiv (Liebe, ehrlich) oder negativ (Gift, hässlich), die Namen klar »weiß« (Paul, Nancy) oder »schwarz« (Tyrone, Latisha).Banaji legte den linken Zeigefinger auf die e-Taste ihrer Tastatur, den rechten Zeigefinger auf die i-Taste. Phase 1: Bei jedem positiven Wort sollte sie links drücken. Bei jedem weißen Namen ebenfalls. Bei jedem negativen Wort rechts, bei jedem schwarzen Namen ebenfalls. Es war sehr einfach, sie musste nicht nachdenken. Ihre Finger drückten fast von selbst, sie war schnell und machte kaum Fehler, das merkte sie.Phase 2: Bei jedem positiven Wort sollte sie weiterhin links drücken – jetzt aber auch bei jedem schwarzen Namen. Bei jedem negativen Wort weiterhin rechts – jetzt aber auch bei jedem weißen Namen. Sie spürte es sofort, sagt sie. Sie war langsamer. Musste plötzlich überlegen, ganz kurz nur, aber merklich. Ihre Hände wurden feucht. Ihr Herz schlug schneller. Sie machte Fehler. Ertappt habe sie sich gefühlt.
Es gab keine wirkliche Auswertung, es war ja noch ein Prototyp, aber Mahzarin Banaji wusste, dass es ihr leichtergefallen war, wenn weiße Namen mit positiven Wörtern kombiniert waren und schwarze mit negativen. Irgendwie passte das besser.Paul und Liebe. Nancy und ehrlich.Tyrone und Gift. Latisha und hässlich.Sie rief ihren Mann an den Esstisch. Ihm ging es genauso. »Er sagte: Diesen Test musst du verstecken – der ist gefährlich.« Banaji und ihr Kollege Greenwald machten das Gegenteil. Im September 1998 stellten sie ihn ins Internet, frei zugänglich für alle.Mit ein bisschen Glück, sagte Banaji zu Greenwald, könnten sie im ersten Jahr 500 Teilnehmer finden, die ihnen Daten für ihre Forschung liefern würden. Es waren dann 45.000 im ersten Monat. Der Uni-Server brach zusammen. Oprah Winfrey berichtete in ihrer Talkshow, der wichtigsten des Landes.Heute ist Mahzarin Banaji Professorin an der Universität Harvard. Aus dem Prototyp ist eine Reihe von Implicit Association Tests (IAT) geworden, jeder kann sie auf der Harvard-Website machen. Einer testet Vorurteile über Geschlechter, einer über Alte, ein anderer über Ostdeutsche; viele Tests gibt es auch auf Deutsch. Am häufigsten aber wird der race test gemacht. Er ist fast unverändert geblieben, seit Banaji ihn damals ausprobiert hat. Statt schwarzer und weißer Namen werden heute lediglich Gesichter gezeigt, das ist eindeutiger. Und jeder Teilnehmer muss explizit die Frage beantworten, ob er Vorurteile gegenüber Schwarzen habe.
Allein mehr als drei Millionen Amerikaner haben den Test mittlerweile gemacht. 73 Prozent der weißen Teilnehmer zeigten unbewusste negative Vorurteile gegen Schwarze. Die meisten von ihnen hatten vorher angegeben, der Hautfarbe von Menschen keine Bedeutung beizumessen. Dennoch brauchten sie etwa 200 Millisekunden länger, um richtig zu antworten, wenn schwarze Gesichter mit positiven Begriffen gepaart waren, als wenn dieselben Gesichter mit negativen Begriffen gepaart waren.»Das klingt nach wenig«, sagt Banaji, »ist aber wahnsinnig viel.«Für die ZEIT haben Mahzarin Banajis Mitarbeiter die Daten der mehr als 50.000 deutschen IAT-Teilnehmer ausgewertet. Das Ergebnis: Wie in den USA sagen die allermeisten Weißen, sie hätten keine Vorurteile gegen Schwarze. 80 Prozent haben sie aber doch. 73 Prozent der weißen Amerikaner. 80 Prozent der weißen Deutschen. Das sind nicht Menschen, die sich in den USA mit Waffengewalt gegen die Bedrohung der weißen Rasse zur Wehr setzen. Es sind nicht Menschen, die in Deutschland gegen den Volkstod durch massenhafte Einwanderung auf die Straße gehen. Es sind nicht diese typischen Trump-Höcke-Wähler. Es sind Menschen wie Mahzarin Banaji, die liberale Harvard-Professorin, Einwanderin und Unterstützerin von Black Lives Matter. Menschen, die in Deutschland vielleicht Petitionen für offene Grenzen unterschreiben und grün wählen. Trotzdem verbinden sie Schwarze mit böse, Hass, Schmutz.
Es scheint tatsächlich Leute zu geben, die beides sind – rassistisch und nichtrassistisch. Sehr viele sogar. Jonathan Haidt würde sagen: Sie werden von ihrem Elefanten beherrscht.
Haidt ist ein anderer Sozialpsychologe aus den USA, und auf den Elefanten kam er, als er darüber nachdachte, welches Tier besonders groß und stark ist. Haidt wollte ein einprägsames Bild schaffen für die Beziehung zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, dem Fühlen und dem Denken. Der Mensch sieht sich gern als rationales Wesen. Das ist er auch, zum Teil. Aber je mehr Psychologen zu diesem Thema forschen, desto klarer wird: Das, was wir Bauchgefühl nennen, obwohl es mit dem Bauch nichts zu tun hat, ist mindestens ebenso wichtig. Laut Haidt sogar wichtiger.
Der Elefant ist das unbewusste Fühlen. Auf ihm sitzt ein Reiter, das ist das bewusste Denken. Der Reiter kann durchaus etwas ausrichten gegen das mächtige Tier, kann es mal bremsen und ihm mal eine bestimmte Richtung vorgeben. Aber meist setzt sich, Haidt zufolge, der Elefant durch. Dass das so ist, liegt daran, wie das menschliche Hirn auf Gefahren reagiert. Am Anfang ist da meist ein Sinneseindruck, man sieht oder hört etwas – eine längliche Form am Boden, ein Knacken im Unterholz. Auge oder Ohr leiten den Impuls sofort weiter an den Thalamus, eine Art Verteilerkasten des Gehirns, der schickt ihn in den Kortex, wo das Denken stattfindet. Nur ein seltsam gebogener Stock, nur das Knacken eines Vogels? Nein, eine Schlange. Der Kortex schickt das Ergebnis zum Gefühlszentrum, der Amygdala, die dem Körper den Befehl zur Flucht gibt.Es existiert aber noch ein anderer Weg, den der Impuls im Gehirn zurücklegt. Er gelangt jedes Mal auch direkt vom Thalamus in die Amygdala, er nimmt eine Abkürzung, vorbei am Kortex. Auf diesem Weg kann der Sinneseindruck zwar nicht durchdacht werden. Aber wie jede gute Abkürzung hat auch diese einen Vorteil: Sie spart Zeit. Den Bruchteil einer Sekunde, der bei einer Begegnung mit einer Schlange den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Der lange Weg, das ist der Reiter. Die Abkürzung, das ist der Elefant.
Der Elefant schafft es, dass wir schon beim ersten Ton eines Songs ein Glücksgefühl empfinden, obwohl der Reiter noch gar nicht verstanden hat, dass da unser Lieblingslied läuft. Der Elefant lässt uns vor der Schlange zurückschrecken, während der Reiter noch die gewundene Form dessen analysiert, was da auf dem Boden liegt. Der Elefant hat es nicht so mit dem Differenzieren. Für ihn gibt es nur harmlos oder gefährlich – und im Zweifel geht er auf Nummer sicher. Lieber einmal mehr einen Stock für eine Schlange halten als einmal falschliegen. Das Urteil fällt blitzschnell. Aber nicht willkürlich. In jedem Moment speichert unser Gehirn, ohne dass wir es merken, die Erfahrung ab, die wir gerade machen. Das Buch, das wir lesen. Den Duft, den wir riechen. Den Menschen, mit dem wir reden. Einfach alles, und es kennt dabei keine Langeweile. Sehen wir in einer TV-Dokumentation zehnmal hintereinander eine Giftschlange, speichert das Hirn zehnmal ab: Schlange gleich gefährlich. Hören wir hundertmal unseren Lieblingssong, speichert es hundertmal ab: Dieser Song gleich Freude. Je größer die Menge der immergleichen Erfahrungen, desto klarer später das Urteil des Elefanten.Schwarz gleich Schmutz, hässlich, Gift, Mord, Bombe, Erbrechen, Krieg, schrecklich, Tod.Weiß gleich Liebe, Freund, ehrlich, Paradies, Himmel, zärtlich, streicheln.
Egal ob in den USA, in Deutschland oder in anderen westlichen Gesellschaften – warum sind in den Zigmillionen Daten des Implicit Association Test diese Verbindungen immer so stabil?
Robin DiAngelo ist Anti-Rassismus-Trainerin in den USA. Sie geht unter anderem in Unternehmen und versucht dort, die Sinne der Mitarbeiter für diskriminierendes Verhalten zu schärfen. In ihrem Buch White Fragility erklärt sie, dass sie oft mit persönlichen Fragen beginne, wenn sie mit weißen Menschen arbeite – Menschen wie mir. Wie sah dein Umfeld als Kind aus?In dem süddeutschen Dorf, in dem ich aufwuchs, gab es nur weiße Menschen (abgesehen von Amir, einem afghanischen Jungen, der mit seiner Familie hergezogen war, eine Zeit lang auf dem Bolzplatz alle ausdribbelte, aber dann schnell wieder weg war).Wann hattest du zum ersten Mal einen Lehrer, der dieselbe Hautfarbe hatte wie du?An meinem ersten Schultag.Wann hattest du zum ersten Mal einen Lehrer, der nicht dieselbe Hautfarbe hatte wie du?
Da muss ich erst mal nachdenken, aber die Wahrheit ist, ich habe die Grundschule, das Gymnasium, zwei Universitäten, eine in Deutschland, eine in Frankreich, und eine Journalistenschule besucht und hatte in den zwei Jahrzehnten, die meine Ausbildung dauerte, keinen einzigen nichtweißen Lehrer oder Dozenten.
Wann hast du zum ersten Mal einen Film gesehen, in dem der Hauptdarsteller dieselbe Hautfarbe hatte wie du?Ich war zu jung, um mich heute daran zu erinnern. Vermutlich war es der erste, den ich je gesehen habe.Freunde, Liebe, Partys – alles, was Spaß machte, als ich aufwuchs, war weiß. Weil das ganze Leben weiß war. Nicht dass ich das bewusst wahrgenommen oder sogar darüber nachgedacht hätte, es war ja normal. Aber mein Erfahrungsspeicher wuchs trotzdem jedes Mal, wenn ich einen Freund traf, um ein paar Einträge. Einer davon: Freund gleich weiß.Wenn man rauszoomt, wenn man also statt des kleinen Dorfs das große Land in den Blick nimmt, dann sieht man eigentlich nichts anderes. Wer ist in Deutschland erfolgreich? Wem wird nachgeeifert? Und, vielleicht am wichtigsten, wer hat das Sagen?Die Bundeskanzlerin: weiß (wie alle ihre Vorgänger).Die Bundesminister: alle weiß.Die Ministerpräsidenten: alle weiß.Der Bundestag: 98 Prozent weiß.Die Dax-Vorstandsvorsitzenden: alle weiß.Die wichtigsten Talkmaster: alle weiß. Die Trainer in der Ersten Bundesliga: alle weiß.Die Tatort-Kommissare: 94 Prozent weiß.Germany’s next Topmodels: 74 Prozent weiß. Die zehn reichsten Deutschen: alle weiß.Die Eiskönigin: weiß.
So dominant sind die unbewussten rassistischen Botschaften in westlichen Gesellschaften, dass selbst deren schwarze Mitglieder sie verinnerlichen
Jesus, Maria, Gott: Sogar sie sind in Deutschland weiß, obwohl das bei Jesus und Maria historisch zweifelhaft ist – und bei Gott würden mir auch ein paar Fragen einfallen.Kein Wunder, dass unser Elefant irritiert ist, wenn beim Implicit Association Test positive Wörter mit schwarzen Menschen gepaart sind. Er kennt das nicht. Er findet im Erfahrungsspeicher keine Einträge dazu. Es kommt noch schlimmer: Schwarze Menschen sind nicht nur nicht mit gut verknüpft, sondern mit schlecht.Der schwarze Mann. Schwarzfahren. Schwarzsehen. Schwarzmalen. Schwarzarbeiten. Schwarzes Schaf. Schwarzer Peter. Engel sind, na klar, weiß. Der Teufel ist schwarz. Im Himmel ist Licht, in der Hölle herrscht Dunkelheit.Als ich groß wurde, sah ich zwar auf der Straße keine schwarzen Menschen, dafür aber im Fernsehen. Die Sendungen handelten meist von Flucht, Krieg und Terror.Einer britischen Kollegin von mir, Reni Eddo-Lodge, ging es zur selben Zeit ähnlich. Anfang der Neunzigerjahre waren auch im englischen Fernsehen die Guten weiß und die Bösen schwarz. Im Alter von vier Jahren, so berichtet sie es in ihrem Buch Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, fragte sie ihre Mutter deshalb, wann sie sich denn endlich in eine Weiße verwandeln werde – sie hielt sich nämlich für einen guten Menschen. So dominant sind die unbewussten rassistischen Botschaften in westlichen Gesellschaften, dass selbst deren schwarze Mitglieder sie verinnerlichen. Fast die Hälfte von ihnen zeigt beim IAT Vorurteile gegen Schwarze. Also gewissermaßen gegen sich selbst.
Ich kann verstehen, wenn jetzt jemand sagt: Millisekunden, unbewusste Vorurteile, Elefanten – erklärt dieser ganze Psychokram wirklich die Realität in einer modernen Gesellschaft? Dafür müsste all dies doch unser Verhalten beeinflussen. Und wenn man davon ausgeht, dass es heutzutage in den meisten Situationen am Ende eben doch auf Vernunft und rationale Kontrolle ankommt, dass also ein gut ausgebildeter Reiter seinen Elefanten bald wieder in den Griff kriegt: Wie viel Schaden kann der Elefant in 200 Millisekunden schon anrichten?
In einem mittlerweile berühmten psychologischen Experiment bekamen die Probanden abwechselnd Bilder von Menschen und Gegenständen gezeigt. Die Menschen waren schwarz oder weiß. Die Gegenstände waren Werkzeuge, zum Beispiel eine Zange oder ein Schraubenschlüssel – oder Pistolen. Sobald die Probanden einen Gegenstand sahen, mussten sie innerhalb einer halben Sekunde einen von zwei Knöpfen drücken, Werkzeug oder Pistole. Alle machten Fehler, aber die Teilnehmer hielten, nachdem sie ein schwarzes Gesicht gesehen hatten, das Werkzeug signifikant häufiger für eine Pistole. Stephon Clark stand, 22 Jahre alt, im Garten seiner Großmutter in Sacramento, als er von Polizisten erschossen wurde. Er hielt ein Telefon in der Hand. Die Beamten sagten, sie hätten gedacht, es sei eine Waffe. Clark war schwarz.Tamir Rice spielte, 12 Jahre alt, in einem Park in Cleveland mit einer Plastikpistole. Ein Polizist erschoss ihn innerhalb von zwei Sekunden nach seinem Eintreffen. Er hatte sie für echt gehalten. Tamir war schwarz.Amadou Diallo wurde, 23 Jahre alt, in New York von Polizisten kontrolliert. Er holte sein Portemonnaie aus der Jackentasche. Die Polizisten erschossen ihn. Später sagten sie, sie hätten es für eine Waffe gehalten. Diallo war schwarz.
Habe ich unbewusste Vorurteile gegen Schwarze, werde ich weniger lächeln, wenn ich einen von ihnen treffe
Wie die Probanden im Experiment entschieden die Polizisten extrem schnell. Gut möglich, dass sie keine bewussten Vorurteile gegenüber Schwarzen hatten, vielleicht waren einige von ihnen überzeugte Antirassisten, einer der Beamten war sogar selbst schwarz. Nur spielte das im entscheidenden Moment keine Rolle. Der Elefant war zu schnell. Es geht nicht immer gleich um Leben oder Tod. Es fängt scheinbar ganz harmlos an. Habe ich unbewusste Vorurteile gegen Schwarze, werde ich weniger lächeln, wenn ich einen von ihnen treffe. Ich werde seltener Augenkontakt suchen, häufiger blinzeln, verhaltener über seine Witze lachen und mit höherer Wahrscheinlichkeit meine Arme vor der Brust verschränken, statt eine Körperhaltung einzunehmen, die Offenheit signalisiert. In Situationen, in denen der erste Eindruck zählt, kann all das einen riesigen Unterschied bedeuten. Die Harvard-Professorin Mahzarin Banaji sagt, ein Arzt, der einem Patienten seltener in die Augen schaut, werde unter Umständen weniger Mitgefühl mit ihm empfinden. Ein Richter könne noch so genau die Akten studieren, er werde vermutlich solchen Aussagen mehr Aufmerksamkeit schenken, die seinen unbewussten Vorurteilen entsprechen, und sein Urteil danach ausrichten.Natürlich lässt sich nicht jeder Arzt, jeder Richter oder jeder weiße Chef, der einen schwarzen Bewerber zum Kennenlerngespräch trifft, von seinem Elefanten beherrschen. Aber oft genug geschieht es eben doch.
So viele Menschen haben in den USA mittlerweile den Implicit Association Test gemacht, dass Forscher die Ergebnisse auf einzelne Landkreise und Stadtbezirke herunterrechnen können. Dort, wo die unbewussten Vorurteile besonders virulent sind, treten nicht nur mehr Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze auf. Dort geht auch der soziale Aufstieg schwarzer Bürger langsamer voran, werden im Vergleich zu weißen besonders viele schwarze Frühchen geboren und besonders viele schwarze Kinder von der Schule verwiesen.Millionen Ärztinnen, Immobilienmakler, Autohändlerinnen, Chefs, Polizisten, Staatsanwältinnen und Richter. Sie alle treffen jeden Tag Entscheidungen, die das System des Rassismus aufrechterhalten. Heißt das, sie alle sind Rassisten? Mahzarin Banaji sagt: Nein. Sie wüssten ja nichts von ihren Vorurteilen, sie hätten sich nicht bewusst entschieden, Rassisten zu sein.Viele Anti-Rassismus-Aktivisten sehen es anders. Die deutsche Autorin Tupoka Ogette zum Beispiel schreibt: »Wenn ich Dir mit einem Auto über den Fuß rolle und diesen dabei breche, verändert sich der Grad Deiner Fußverletzung dann gemessen daran, ob ich es bewusst oder unbewusst gemacht habe?« Die Absicht ist egal, soll das heißen, es geht ums Ergebnis. Folgt man diesem Argument, dann gibt es, grob gesagt, drei Arten von Rassisten.
Die Unbelehrbaren. Das sind die Menschen, die offen hassen, hetzen, töten. Neonazis zum Beispiel. Und wann hat eigentlich ein Polizist zuletzt sein Knie knapp neun Minuten lang in den Nacken eines Weißen gepresst, während dieser mehr als 20 Mal sagte, er könne nicht atmen?Die Verheimlicher. Also die Menschen, die ihren Glauben an die Überlegenheit der Weißen hinter einer Fassade der Harmlosigkeit verstecken. Schließlich die Wohlmeinenden. Dazu gehören Mahzarin Banaji und die allermeisten anderen. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich sinnvoll ist, solche Menschen als Rassisten zu bezeichnen. Ob der Begriff dadurch nicht jegliche Trennschärfe verliert. Inzwischen denke ich: Er gewinnt an Trennschärfe, indem er jene ins Licht rückt, die Teil des Problems sind, ohne es zu ahnen. Jene in der Mitte der Gesellschaft, die sich, wenn sie in Deutschland leben, gegen Neonazis und die Facebook-Hetzer von der AfD aussprechen und finden, damit hätten sie genug getan. Natürlich ist es wichtig, Rechtsradikale zu bekämpfen, sehr sogar, aber es reicht nicht. Eine gesellschaftliche Mitte, die den Rassismus besiegen will, darf nicht nur auf die Ränder zeigen. Sie muss sich selbst hinterfragen. Bill Clinton versuchte es damals mit rationalen Argumenten, DNA, Basenpaare, 99,9 Prozent. Er richtete sich an die Reiter seiner Zuhörer. Nur waren die gar nicht das Problem, die meisten hatten es längst verstanden. Das Problem war, dass sie ihre Elefanten nicht in den Griff bekamen.
Mahzarin Banaji hatte mal einen Studenten, der jeden Tag den IAT machte, um sich zu verbessern. Die Resultate blieben gleich. Bis der Student eines Tages deutlich besser abschnitt. Am Vormittag hatte er die Leichtathletik-Wettbewerbe der Olympischen Spiele angeschaut. Ein paar Stunden lang hatte er Bilder gesehen von schwarzen Menschen, die gewannen. Von weißen Menschen, die verloren. Das reichte. Eine Studentin von Banaji hatte einige Jahre später eine Idee. Bevor sie Probanden den Test machen ließ, zeigte sie einigen von ihnen Fotos von schwarzen Helden, Martin Luther King, Michael Jordan, Eddie Murphy, und Fotos von weißen Antihelden, zum Beispiel von Serienkillern wie Ted Bundy und Charles Manson. Die Menschen, die die Fotos gesehen hatten, zeigten daraufhin messbar weniger Vorurteile gegen Schwarze. Nach einer Woche war der Effekt allerdings wieder verschwunden, sagt Banaji. In der Zwischenzeit hatte der amerikanische Alltag das Gelernte begraben unter Weiß ist gut- und Schwarz ist schlecht-Erfahrungen.
Die Offenheit gegenüber Menschen, die anders aussehen als man selbst: Man kann sie trainieren wie einen Muskel
Hätte ich selbst den IAT als Teenager absolviert, wäre das Ergebnis nicht sehr schmeichelhaft für mich gewesen, da bin ich sicher. Als ich ihn dann aber 2018 zum ersten Mal machte, bekam ich das Ergebnis: Keine Vorurteile, weder gegen Schwarze noch gegen Weiße. Ich war ein bisschen stolz, aber auch überrascht. Inzwischen lebe ich zwar nicht mehr im Dorf, sondern in einem sehr diversen Viertel Hamburgs, doch meine Familie, meine besten Freunde, meine engsten Kollegen sind alle weiß. Ich hatte auch keine Leichtathletik geschaut, bevor ich mich an den Computer setzte und die IAT-Website öffnete. Aber dann fiel mir ein, dass ich in den Monaten zuvor für Recherchen häufig in Afrika gewesen war. Wochenlang hatte ich dort ausschließlich mit schwarzen Menschen zu tun gehabt, mit erfolgreichen, netten, schlauen. Vielleicht hat das mein Ergebnis beeinflusst.Ja, es ist schrecklich, dass die Art von Diskriminierung, um die es in diesem Artikel geht, so weitverbreitet ist. Die gute Nachricht lautet, man kann etwas dagegen tun. Ich habe Rassismus immer für eine Entweder-oder-Sache gehalten: Entweder bist du ein unverbesserlicher Rassist, oder du bist es nicht. Im Fall der Unbelehrbaren und der Verheimlicher stimmt das auch. Alle anderen können ihre Offenheit gegenüber Menschen, die anders aussehen als sie selbst, aufbauen wie einen Muskel.
Eine große Trainingshilfe wäre es, wenn endlich mehr nichtweiße Menschen in öffentlich sichtbare Positionen aufrücken würden. In Talkshows erklären schwarze Politikerinnen ihre Pläne für den Ausbau der digitalen Infrastruktur. In Kitas geben schwarze Polizisten Verkehrsunterricht. Schwarze Geschichtslehrerinnen erzählen Schülern vom Fall der Berliner Mauer, schwarze Wissenschaftler sitzen auf Podien und erläutern die Fortschritte im Kampf gegen den Krebs, schwarze Firmenchefinnen verkünden Bilanzzahlen. Der Anfang ist ja schon gemacht.Die Trainer in der Ersten Bundesliga sind zwar alle weiß. Aber in der Zweiten Bundesliga, beim Hamburger SV, ist Daniel Thioune der Coach.Die Parlamente sind sehr weiß. Aber im schleswig-holsteinischen Landtag ist Aminata Touré Vizepräsidentin.Im Tatort ermitteln fast nur weiße Kommissare. In Göttingen aber eben auch Anaïs Schmitz, gespielt von Florence Kasumba.Germany’s aktuelles Topmodel ist weiß. Aber in der Vergangenheit gewannen auch: Sara Nuru, Alisar Ailabouni, Toni Dreher-Adenuga, Lovelyn Enebechi.
Wo sich Deutschland befindet auf dem Kontinuum zwischen Reicht-doch-schon und Längst-noch-nicht-genug, mag jeder für sich selbst beantworten. Eines aber lässt sich nicht bestreiten. Jedes Mal, wenn Anaïs Schmitz einen Mörder fasst, jedes Mal, wenn der HSV trifft und die Kamera auf den jubelnden Trainer schwenkt, jedes Mal, wenn Aminata Touré eine Rede im Plenum hält, jedes Mal, wenn Sara Nuru, Alisar Ailabouni, Toni Dreher-Adenuga und Lovelyn Enebechi von der Titelseite irgendeiner Illustrierten lächeln, werden überall in Deutschland Gehirne unbewusst Verbindungen abspeichern: Schwarz gleich smart. Schwarz gleich erfolgreich.Schwarz gleich schön. Schwarz gleich deutsch.
Test
Auf der Website der Universität Harvard kann jeder – auch auf Deutsch – seine eigenen unbewussten rassistischen Vorurteile überprüfen:
implicit.harvard.edu